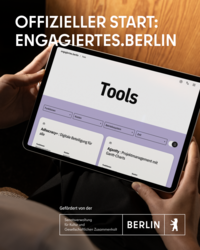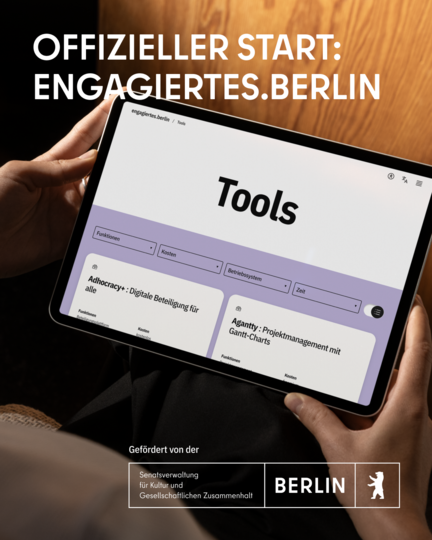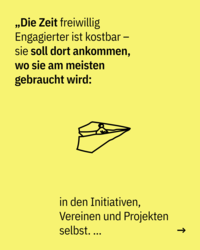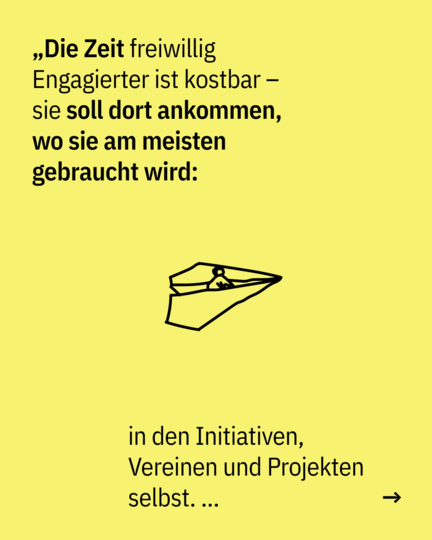Seit Wochen gehen Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straße. Viele gemeinnützige Vereine möchten sich daran beteiligen. Doch es gibt Unsicherheit: Dürfen gemeinnützige Organisationen zu Demos aufrufen, mitmachen oder sie sogar mitorganisieren? Und wo liegen die Grenzen des Erlaubten?
Gelegentliches Engagement ist erlaubt
Wenn ein Verein nur vereinzelt zu einer Demo aufruft, teilnimmt oder sie unterstützt, ist das rechtlich kein Problem. Das Bundesfinanzministerium hat dies Anfang 2022 im sogenannten Anwendungserlass zur Abgabenordnung klargestellt. Dort steht: Es ist in Ordnung, wenn eine steuerbegünstigte Organisation ausnahmsweise zu aktuellen politischen Themen Stellung nimmt – zum Beispiel mit einem Aufruf gegen Rassismus. Dafür dürfen auch Gelder des Vereins genutzt werden.
Wichtig ist, dass solche Aktionen nicht zur Regel werden. Wann genau das Kriterium „vereinzelt“ überschritten ist, bleibt allerdings unklar. Wenn der Verein auf einen konkreten Anlass reagiert – etwa einen rassistischen Vorfall –, ist das ein starkes Zeichen dafür, dass die Aktion erlaubt ist.
Wenn das Engagement dauerhaft wird: Satzungszweck prüfen
Sollten Demonstrationen und politische Stellungnahmen regelmäßig zur Vereinsarbeit gehören, empfiehlt es sich, die Satzung anzupassen . Denn: Gemeinnützig dürfen nur Tätigkeiten sein, die einem gesetzlich anerkannten gemeinnützigen Zweck dienen. Demokratie- und Menschenrechtsarbeit ist derzeit nicht ausdrücklich im Gesetz genannt. Der Zweck „Förderung des demokratischen Staatswesens“ wird in der Praxis außerdem eng ausgelegt. Viele Organisationen helfen sich mit anderen Zwecken wie „Völkerverständigung“ oder „Toleranz auf allen Gebieten der Kultur“.
Achtung: Politische Aktivitäten dürfen nicht überwiegen
Laut Anwendungserlass dürfen gemeinnützige Organisationen zwar politische Mittel einsetzen – wie Stellungnahmen, Forderungen oder Demos. Diese müssen aber im Vergleich zur sonstigen Arbeit „in den Hintergrund treten“. Was genau politische Mittel sind, ist nicht eindeutig definiert. Wer sich dauerhaft auf politische Einflussnahme konzentriert, riskiert, den Gemeinnützigkeitsstatus zu verlieren. Daher fordern viele Organisationen eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts.
Keine Parteiförderung – aber klare Haltung erlaubt
Gemeinnützige Vereine dürfen keine Partei fördern – weder direkt noch indirekt. Sie dürfen jedoch politische Forderungen äußern und bewerten, ob Parteien diese unterstützen oder ablehnen. Auch Kritik an Parteien ist erlaubt – solange sie sich aus dem gemeinnützigen Zweck des Vereins ergibt. Wer sich etwa für Menschenrechte oder gegen Antisemitismus einsetzt, darf dazu auch öffentlich Stellung beziehen. Ein generelles Gebot zur Neutralität gibt es für zivilgesellschaftliche Organisationen nicht.
Was Vereine tun können
Im Zweifel sollten Vereine mit dem zuständigen Finanzamt sprechen. Dokumentiert vorher genau, warum und wie ihr euch äußern wollt. Die rechtliche Lage ist komplex, aber sie ist gestaltbar. Wichtig ist: Der Einsatz für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit ist legitim – und darf auch öffentlich sichtbar sein. Gemeinnützige Organisationen sollten selbstbewusst ihre Arbeit vertreten.